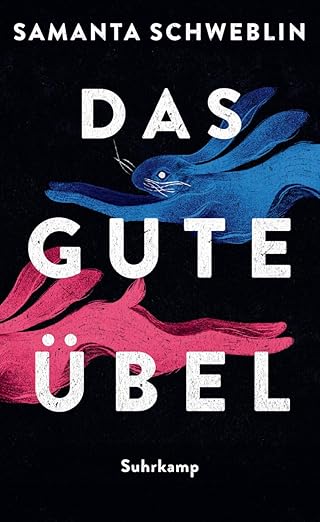Die Kratzgeräusche des toten Katers, die anonymen Anrufe Nacht für Nacht, der Eindringling in der Wohnung – die Nackenhaare stellen sich mehr als einmal auf, wenn man sich auf Samanta Schweblins Kurzgeschichten einlässt. Dabei zielt die Argentinierin nicht auf einen schnell verfliegenden Kitzel. Vielmehr nutzt sie all das Unheimliche, das durch die Szenerie geistert, um die psychischen Verwerfungen der Protagonisten aufzudecken. Das mag den eigentümlichen Titel „Das gute Übel“ rechtfertigen. Denn durch die äußere Zuspitzung, durch das plötzlich in den Alltag einbrechende Böse-Mysteriöse, wird die innere Krise freigelegt.
Die Seniorin, ihr Sohn und der Schreck
Das Erschrecken kommt gewiss. Über kurz oder etwas länger. Das eine Mal sitzt gleich zu Beginn eine Frau, mit Steinen beschwert, auf dem Meeresgrund, um ihrem Leben ein Ende zu setzen. Das andere Mal dauert es drei Seiten, ehe die Besucherin eines Seniorenheims von einer Bewohnerin gebeten wird, ihr etwas Geld für die U-Bahn zu leihen. Damit fängt das Übel an.
Zunächst will Lidia – so heißt die Besucherin – die Suche nach den Münzen nur vortäuschen. Doch dann hält sie tatsächlich etwas Kleingeld in der Hand, und schon greift die Seniorin zu. Wie es anschließend dazu kommt, dass Lidia mit der alten Frau in der U-Bahn fährt, sie dann in ihrer Wohnung verköstigt, dem herbeigeeilten Sohn der Fremden die Türe öffnet, der alsbald Lidias gestörtes Verhältnis zur Tochter aufdeckt, eine Schusswaffe präsentiert, etwas Psychoterror betreibt und schließlich mit seiner Mutter und geraubtem Geld in aller Seelenruhe die Wohnung verlässt – das ist eine Story vom Feinsten.
Der Anrufer, der nichts sagt
Vielleicht die stärkste unter den sechs monsterstarken Geschichten, die bis auf eine in Argentinien angesiedelt sind, ist in der Mitte des Bandes platziert: „Das Auge in der Kehle“. Der Ich-Erzähler schildert zunächst, wie er als Kleinkind eine Batterie verschluckt hatte, worauf er zu ersticken drohte und ihm die Luftröhre aufgeschnitten wurde. Darüber verliert er seine Stimme. Jahre später vergessen die Eltern das hoch intelligente Kind, das sie ansonsten wie ihren Augapfel hüten, auf einer Autofahrt durch die argentinische Provinz an einer Tankstelle.
Zum Glück wird der Junge gefunden. Doch danach setzen die nächtlichen Anrufe ein. Sie bringen den Vater, einen Handelsvertreter, um den Schlaf: Wann immer er den Hörer abnimmt – wir befinden uns noch in den 1990er Jahre, also jenseits der Smartphone-Ära –, gibt es keine Antwort am anderen Ende der Leitung. Da ist jemand am Apparat. Aber die Person sagt nichts. Ist es der eigenartige Pächter der Tankstelle, ist es ein Fremder, ist es ein Verwandter? Wie all das auf spektakuläre Weise zusammenhängt, darf hier selbstverständlich nicht verraten werden.
Der Junge will ein Pferd sein
Samanta Schweblin hat ein besonderes Gespür für Plot und Psyche. Ihre wunderbar wundersamen Geschichten blicken in Abgründe, an deren Basis die Schriftzüge Enttäuschung und Verlust eingebrannt sind. Auch werden einige Familiengeheimnisse gelüftet. Die Originalität, die jeder Geschichte eigen ist, dient keinem Selbstzweck. Vielmehr wird alles aus einem tiefen Verständnis für die Probleme der Protagonisten hergeleitet. Dabei lernen wir Heldinnen und Helden kennen, denen ihr Leben aus dem Gleis gesprungen ist.
Rätselhaft wirkt zunächst alles, was zur Sprache kommt. Der Junge, der ein Pferd sein will, und vom Dach stürzt (und wer weiß, wie es dazu kam?). Die Frau, die ihren verstorbenen Kater hört (und wer weiß, was das für ihre Ehe bedeutet?). Die Alkoholikerin, die von zwei Mädchen auf eigentümliche Weise gepflegt wird (und wer weiß, warum sie Jahrzehnte später kostenlos frisiert wird?). Lauter Literaturknäuel, die dazu einladen, an diesem oder jenen Faden zu ziehen. Samanta Schweblin wartet nicht mit eindeutigen Antworten auf. Aber sie gibt die Richtung vor.
Aus dem Lot geraten
Die Geschichten passen nur zu gut zum weit verbreiteten Gegenwartsgefühl, dass die Welt aus dem Lot geraten ist. Doch nicht die öffentliche Bühne, sondern der private Raum wird hier besichtigt. Sicherheit gibt es an keiner Stelle. Das Übel lauert überall. Mal schabt es im Unterbewusstsein, mal bricht es leibhaftig in den Haushalt ein. Um dem Unheimlichen Raum zu verschaffen, muss die Autorin nicht auf Bühnentricks zurückgreifen, auf Nebelschwaden oder Rabengekrächze, geblähte Vorhänge oder zuckende Blitze. Auch sprachlich rüstet sie nicht sonderlich auf. Es genügt ihr, eine Geschichte zügig Seite für Seite voranzutreiben: nicht das Setting ist beängstigend, sondern das sorgsam servierte Geschehen selbst.
Samanta Schweblin, 1978 in Buenos Aires geboren, veröffentlicht ihre Kunst seit 25 Jahren. In dieser Zeit hat sie jede Menge Anerkennung erfahren, in Lateinamerika ebenso wie in Europa. Auch war sie schon für den Booker Prize nominiert. Mittlerweile hat sie ihren Wohnsitz nach Berlin verlegt. Gleichwohl ist sie hierzulande immer noch eine Autorin, die es zu entdecken gilt. „Das gute Übel“ bietet dazu eine großartige Gelegenheit.
Martin Oehlen
Samanta Schweblin: „Das gute Übel“, dt. von Marianna Gareis, Suhrkamp, 192 Seiten, 25 Euro. E-Book: 21,99 Euro.