
Daniel Kehlmann war schon in vielen Leben unterwegs. Mit oft großem bis sehr großem Erfolg. Sein 20 Jahre alter Roman „Ich und Kaminski“ ist ein immer noch famoser Kunstbetriebs-Spaß. Aus der Begegnung des Mathematikers Carl Friedrich Gauß und des Naturforschers Alexander von Humboldt wurde der höchst unterhaltsame Bestseller „Die Vermessung der Welt“. Zuletzt ist er mit „Tyll“ Ulenspiegel auf spektakuläre Weise durch den Dreißigjährigen Krieg gezogen. Nun also der achte Streich: „Lichtspiel“. Der Roman wird womöglich wieder ein Bestseller. In einigen begeisterten Rezensionen ist gar von Daniel Kehlmanns bislang größtem Werk die Rede. Doch gar so sehr hoch wollen wir nicht greifen.
Erfolge in der Weimarer Republik
Im Zentrum diesmal: der österreichische Filmregisseur Georg Wilhelm Pabst (1885-1967), der als G. W. Pabst in die Filmgeschichte eingegangen ist. Er tat dies vor allem mit Werken, die in der Weimarer Republik entstanden sind: „Die freudlose Gasse“ (1925) und „Die Büchse der Pandora“ (1929), „Die Dreigroschenoper“ (1931) und „Kameradschaft“ (1931). Aber davon ist bei Daniel Kehlmann nur am Rande die Rede. Stattdessen liegt der Fokus auf dem Wirken des Regisseurs zu Zeiten des Nationalsozialismus.
G. W. Papst, der als „links“ galt, war nach der Machtergreifung der Nazis nach Hollywood gegangen. Doch anders als andere Emigranten fand er sich in der kalifornischen Fremde nicht zurecht. Der Flop seines Films „A Modern Hero“ (1934) veranlasste ihn zur Rückkehr aus den USA nach Europa.
„Natürlich nicht ganz ohne Kompromisse“
In Frankreich kommt er wieder ins Geschäft. Dreimal führt er dort Regie. Dann der persönliche Gau: Er entschließt sich 1939, seine Mutter in Österreich zu besuchen. Gemeinsam mit Ehefrau Trude und Sohn Jakob. Ein fataler Schritt in die „Ostmark“ des NS-Staates. Denn just in jenen Tagen wird Polen überfallen, beginnt der Zweite Weltkrieg, sind die Grenzen geschlossen und ist der Rückweg nach Frankreich versperrt. Pabst sitzt mit den Seinen in der Falle.
Der Regisseur, der sich seiner Schnitt-Kunst rühmt, zeigt sich gegenüber den Avancen der Nazi-Diktatur zunächst abwehrend. Doch das dauert nicht länger als ein Gespräch mit Propagandaminister Joseph Goebbels. Heinz Rühmann hatte dem Regisseur am Vorabend der Audienz den Hinweis gegeben: „Ganz ohne Kompromisse gehe es natürlich nicht.“ Goebbels formuliert es bei der Begegnung mit Pabst konkreter: „Es ist, wie es ist, und wie es ist, sage ich…“ Pabst beugt sich der Erpressung und schlägt ein: Er inszeniert fortan im Auftrag der Diktatur.
„Das hier sind jetzt meine Umstände“
Nicht dass er nun zum glühenden Nazi mutierte. Aber der Roman zeigt überzeugend die Korrumpierbarkeit des Künstlers. Der Regisseur richtet sich sehr gut ein in seiner allseits geförderten Filmnische. Seine Frau lässt er wissen: „Wichtig ist, Kunst zu machen unter den Umständen, die man vorfindet. Das hier sind jetzt meine Umstände. Und weißt du, so schlecht sind sie nicht.“ So entstehen zunächst die „Komödianten“ (1941) und „Paracelsus“ (1943). Und dann noch „Der Fall Molander“ (1945). Aber den wird nie jemand sehen.
Pabst dreht „Molander“ in den letzten Kriegstagen in Prag. Zu dem Zeitpunkt sind selbst für ihn die Mittel begrenzt. Weil Arbeitskräfte fehlen, bauen Kriegsgefangene das Bühnenbild (in den heute noch existierenden Barrandov-Studios). Und weil keine Statisten verfügbar sind, werden sie – so wird es suggeriert – aus einem KZ rekrutiert (wie tatsächlich zuvor geschehen für Leni Riefenstahls „Tiefland“). Pabst zittern nur ein wenig die Hände, wenn er daran denkt. Seine Sicht: Es gehe alles vorüber, aber es bleibe die Kunst. Ehefrau Trude sieht es anders. Sie ist es, die in diesem Roman die Kritik formuliert. Zögerlich zwar, aber dennoch deutlich. Selbst wenn es so sei, sagt sie, selbst wenn sie bleibe, die Kunst: „Bleibt sie nicht beschmutzt? Bleibt sie nicht blutig und verdreckt?“
„Sinn für Angemessenheit“
„Der Fall Molander“ ist die Klammer dieses Buches – mit ihm beginnt und mit ihm endet das „Lichtspiel“. Dazwischen blättert Daniel Kehlmann in einem abwechslungsreichen Bilderbogen aus Faktum und Fiktion. Das Fundament ist historisch nachweisbar, die Feinstruktur allerdings modifiziert und erfunden. Dass dies ein legitimes Verfahren sein kann, hat Daniel Kehlmann selbst in seiner Schillerpreisrede „Über Historie und Fiktion“ im vergangenen Jahr in Marbach festgehalten.
Darin stellt er fest: „Wer über die Lebenden schreibt, muss sich vorsehen, denn sie können sich wehren, notfalls mit Hilfe der Gerichte. Während der Fall bei den Verstorbenen umgekehrt liegt. Schreibst du über sie, musst du dich vorsehen, weil sie dir ausgeliefert sind. Das einzige, was sie schützt, ist dein Sinn für Angemessenheit.“ Warum es überhaupt lohnend sein kann, sich in das Leben der Anderen einzufinden, erfahren wir kurz vor Schluss der Rede: „Das Erfinden verwischt nicht nur manche Wahrheit, es lässt auch Wahrheit hervortreten.“
„Gaima aoufi“
Hier also nur noch einmal fürs Protokoll: Dies ist keine Biografie des G. W. Pabst, sondern ein Roman, der auf einigen biographischen Facetten des Regisseurs fußt, um vom Künstler in der Diktatur zu erzählen. Die meist kurzen Kapitel wechseln die Schauplätze und Perspektiven wie in einem Abenteuerfilm. Allerdings fällt auf, dass es dem Autor nicht gelingt, eine Nähe zu den Figuren herzustellen. Das liegt nicht nur daran, dass einige Protagonisten tiefste Abscheu auslösen. Auch bleiben einem die Charaktere fremd, weil sie nur schemenhaft gezeichnet werden. Und bei den Randfiguren geht es auch mal klischeehaft zu: „Metzgervisage über der Uniform“.
Daniel Kehlmann trägt immer dann besonders dick auf, wenn die Bösen ins Spiel kommen. Der verschlagene Hausmeister ist ein Satansbraten, dessen österreichische Mundart wie eine Waffe klingt („Gaima aoufi“). Zwei Nazi-Schergen machen sich einen ironischen Spaß daraus, einen Drehbuchautor zu verhaften. Und der Propagandaminister liefert eine Blaupause dafür, was eiskalte Machtausübung konkret bedeutet. Das ist durchaus packend – aber auch ein wenig plakativ. Jedenfalls wünschte sich man von einem Autor dieser Güte mehr Finesse.
Späße mit der Kommunikation
Noch eine letzte Meckerei! Die Komik, eine der Vorzüge in Daniel Kehlmanns bisherigem Oeuvre, wirkt wie vom Reißbrett. Sie setzt auf die Späße der kommunikativen Verwirrung: Beim deutsch-englischen Dialog (Pabst ist da eher schwach unterwegs), in der Konfrontation mit dem Dialekt („dazu sagte er etwas, das wie Krankhockpfrhockhick klang“) oder bei der Begegnung mit dementen Personen (darunter der ehemalige – und erfundene – Regieassistent).
„Lichtspiel“ ist die Geschichte eines Regisseurs, dem die Kunst wichtiger ist als die Moral. Der das Nazi-Übel sieht, aber sich ihm nicht verweigert. Der sich schließlich einredet, nichts falsch gemacht zu haben. Selbst wenn die Familie nach England gegangen wäre, merkt er einmal an, hätte doch die Gefahr bestanden, bei einem Bombenangriff zu Schaden zu kommen. Das ist ein starker Stoff. Aber ein nicht ganz so starker Roman.
Martin Oehlen
Lesungen mit Daniel Kehlmann
gibt es in Wien (15. 10. 2023), Frankfurt (am 19. und 20. 10.), Köln (21. 10.), Essen (22. 10.), Leipzig (26. 10.), Göttingen (27. 10.), Hamburg (28. 10.), Bremen (6. 11.), Hannover (9. 11.), Basel (19. 11.), Karlsruhe (20. 11.), Salzburg (27. 11.) und München (28. 11. 2023). Weitere Termine folgen.
Daniel Kehlmann: „Lichtspiel“, Rowohlt, 478 Seiten, 26 Euro. E-Book: 22,99 Euro.
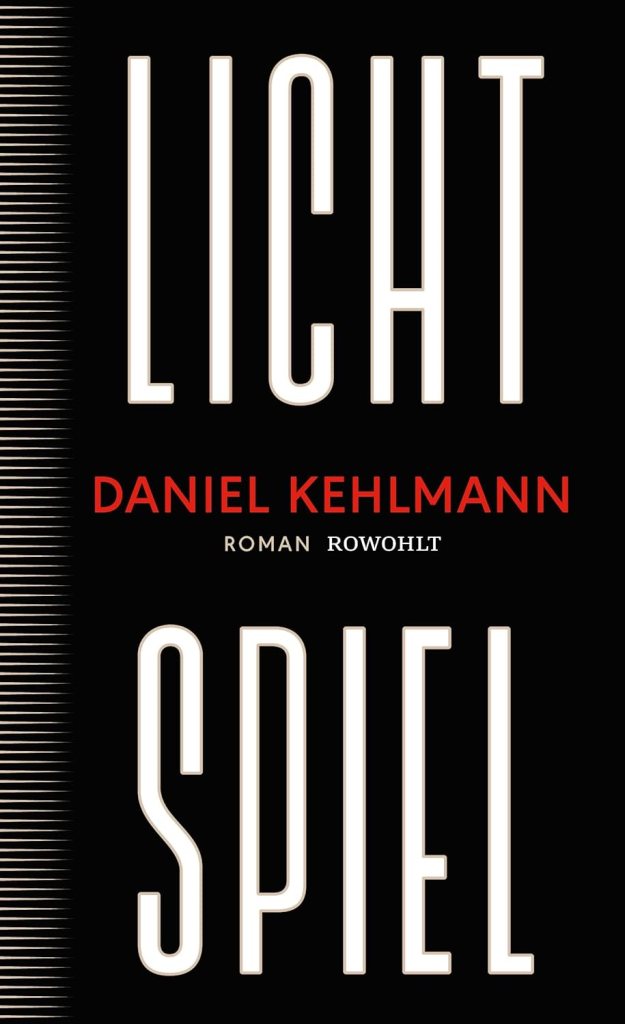
Ich habe erst 10%, aber mich ärgern Klischees von „dummen Frauen“ und „klugen Jungens“ bereits jetzt, auch habe ich noch nie so viele Punkte auf einmal auf meinem E-Book-Reader gehabt. Die Sätze sind ja irre kurz geraten. Ich bleibe aber, so weit es mir möglich ist, offen für Weiteres. Nur hat diese Besprechung mir nicht viel Hoffnung gemacht 🙂 Vielleich doch lieber den Heimito von Doderer direkt lesen, der das Motto gibt. Viele Grüße!
LikeGefällt 2 Personen
Ich bin gespannt auf das finale Urteil! Auch das Name-Dropping („wie Marlene“) fand ich nicht so toll. Herzliche Grüße, M. Oe.
LikeLike